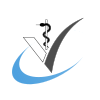Unter benigner Prostatahyperplasie (BPH; gutartige Vergrößerung der Prostata) versteht man eine primär nicht-entzündliche Vergrößerung der akzessorischen Geschlechtsdrüse durch einfache Proliferation ihrer epithelialen und mesenchymalen Bestandteile. Die BPH betrifft bevorzugt Rüden im fortgeschrittenen Alter, d.h. die älter als 5 Jahre sind. Der Strukturwandel des Drüsenepithels hingegen beginnt bereits im Alter von zwei Jahren und führt mit der Zeit zu multiplen, intraprostatischen kleinen Zysten, die mit einer glasklaren bis gelblichen Flüssigkeit gefüllt sind. Diese Zysten können im fortgeschrittenen Stadium auch über die Prostataoberfläche vorragen.
Bei unkastrierten Rüden vergrößert sich die Prostata im Verlauf des Alterns zunehmend, sodass ab dem 9. Lebensjahr das Organ in 95 % der Fälle von Zysten mit unterschiedlichem Durchmesser durchsetzt ist. Der Großteil der betroffenen Rüden entwickelt jedoch keine klinisch manifeste Erkrankung.
Ätiologie/Pathogenese
Als Ursache für die BPH gilt die Akkumulation von Dihydrotestosteron (DHT) in der Prostata, die auf zwei Veränderungen im Hormonhaushalt alternder Rüden zurückzuführen ist:
-
Reduktion der Testosteroninkretion mit dadurch bedingter Verschiebung des Gleichgewichts der Sexualsteroide zugunsten der Östrogene (17-β-Östradiol induziert Rezeptoren für DHT).
-
Deutlich reduzierter Katabolismus von Dihydrotestosteron in der Prostata.
Diese Veränderungen führen zu einer Vermehrung und Vergrößerung der Drüsenepithelzellen sowie zur Bildung kleiner Zysten.
Sympthome
Die BPH verläuft meist klinisch inapparent und führt erst im fortgeschrittenen Stadium zu Symptomen:
-
Kotabsatzschwierigkeiten
-
plattgedrückter, bandförmiger Kot
-
intermittierendes Abträufeln von gelblich bis blutig-serösem Sekret aus der Urethra (Harnröhre)
-
sporadische oder permanente, geringe Hämaturie (Blut im Urin)
Die Rüden sind meist bei gutem Allgemeinbefinden und zeigen keine Anzeichen einer systemischen Erkrankung.
Als Folge einer Vergrößerung des Organs können Perinealhernien (Dammbruch) auftreten.
Diagnose
-
Rektale Untersuchung
Hinweise auf Grösse, Beschaffenheit und Schmerzhaftigkeit. Bei der rektalen Palpation ist die Prostata nicht druckdolent, jedoch symmetrisch vergrößert und weist eventuell eine höckrige Oberfläche auf. -
Röntgen
Darstellung der Grössen- und Lageveränderungen. Im seitlichen Röntgenbild ist die Prostata als eine weichteildichte Masse erkennbar, die sich kaudal dem Harnblasenhals anschließt. Die Drüse gilt als vergrößert, wenn ihr ventrodorsaler Durchmesser zwei Drittel der Distanz von der Beckensymphyse zum Iliosakralgelenk übersteigt. Im fortgeschrittenen Stadium führt die hyperplastische Prostata zu einer Kompression des Rektums und verdrängt zusätzlich die Harnblase in kranialer Richtung. -
Ultraschall
Darstellung der inneren Struktur sowie der genauen Größe. In der Ultraschalluntersuchung stellt sich das Organ normal bis hyperechogen dar, wobei häufig hyperechogene Zysten verschiedener Größen erkennbar sind. -
Blutuntersuchung
Messung der Canine Prostata Spezifische Arginin Esterase (CPSE). Das Enzym CPSE wird unter Kontrolle der Sexualsteroide, v.a. Testosteron, durch die Prostatazellen sezerniert. Wenn die Prostatazellen hyperplastisch werden, steigt CPSE signifikant an.
Grundsätzlich kommen diffenrenzialdiagnostisch weitere mit einer Vergrößerung einhergehenden Prostataerkrankungen bzw. Folgeerkrankungen infrage und müssen ausgeschlossen werden, z.B.:
-
Prostataabszess
-
Prostatametaplasie
-
Prostatitis
- Prostatatumor
Therapie
Diese hat vor allem das Ziel, den Testosteron- Einfluss auf die Prostata zu minimieren, dazu gibt es verschieden Optionen:
-
chirurgische Kastration
effektivste und dauerhafte Behandlung, eine Volumenabnahme (Involution) ist nach 3 Wochen um etwa 50 % und nach 9 Wochen um 70 % festzustellen -
medikamentelle Behandlung
zum Einsatz kommen Antiandrogene wie Delmadinon, Osateron, Finasterid oder Deslorelin
Prophylaxe
Vorteilhaft ist es – gerade bei älteren Hunden - die Prostata ein- bis zweimal jährlich routinemässig untersuchen zu lassen.